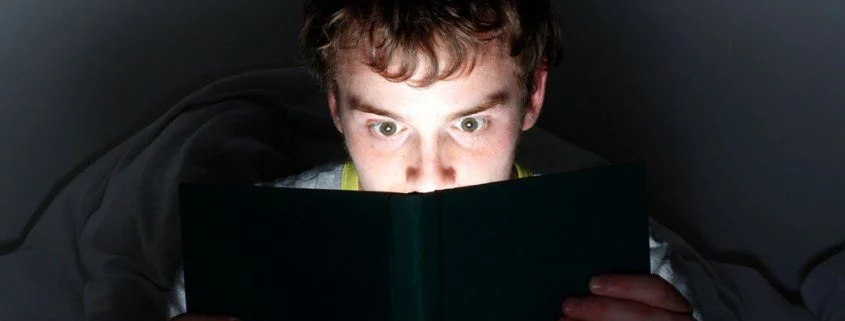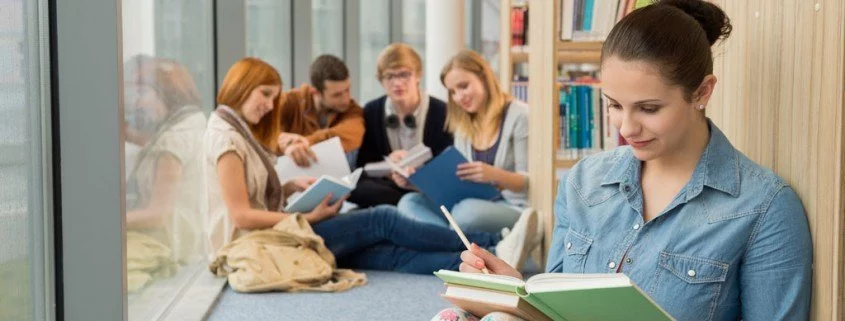Viele Migränepatienten sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Wetterumschwüngen und ihren Migräneattacken. In einer Umfrage von 2007 sagten rund 53 Prozent der Befragten, dass das Wetter ihre Migräneanfälle beeinflussen würde. Diese Aussagen machten das Wetter zum dem zum vierthäufigsten Auslöser für Migräne, auch als Trigger bezeichnet. Das Wetter steht damit hinter Stress, dem weiblichen Hormonzyklus und […]
Archiv für die Kategorie: Psychologie im Alltag
Du bist hier: Home » Psychologie im Alltag » Seite 10
Psychologie im Alltag
Aus den Hörsälen sind Laptops, Smartphones und Tablets nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, sich Notizen zu machen. Dennoch sollten Stift und Papier in ihrer Effizienz nicht unterschätzt werden. Das konnten jetzt die Psychologen Pam Mueller und Daniel Oppenheimer zeigen: In einer Studie wurden 65 Teilnehmern Videos von Vorträgen gezeigt. Die Hälfte sollte sich […]
Liest Du auch gerne die letzte Seite in einem Buch als erstes? Schaust Du im Internet wie ein Film endet und gehst danach trotzdem noch ins Kino? Recherchierst Du überall danach, wie es in Deiner Lieblingsserie weitergeht, weil Du nicht auf die nächste Folge warten willst? Dann zählst Du nicht zu den Menschen, die Spoilern […]
Dass wir uns unsere Vorbilder auch mal in Film und Fernsehen suchen, ist hinlänglich bekannt. Superhelden ebenso wie schräge Schurken begeistern die Zuschauer und färben gewissermaßen auf sie ab. Sie fungieren für uns als Vorbilder und nicht selten übernehmen wir auch mal Verhaltensweisen von ihnen. Eine Studie der Universität Colorado at Boulder hat untersucht wie […]
Gut gemeinte Ratschläge wie “Mehr Bewegung tut dir gut!” oder “Du solltest nicht so viel Alkohol trinken!” sind ja wirklich nett gemeint, aber möchten wir sie wirklich hören? Oder gibt es Möglichkeiten, dass sie bei uns besser ankommen? Durch ständiges Sitzen und wenig Bewegung fühlen wir uns matt und werden krank. Daher ist es wichtig, […]
Wer welche Musik und vor allem wieso gerne hört, ist ziemlich vielen Menschen ein Rätsel. Und doch interessiert es so manchen wieso wir beispielsweise lieber Rap statt Klassik bevorzugen. Forscher der Universität aus Washington haben sich diesem Thema in Form einer Studie mit etwa 4000 Menschen gewidmet. Dabei untersuchten die Forscher vordergründig, ob der kognitive […]
Eine gesunde Ernährung ist so ziemlich jedermanns Ziel. Besonders wenn es um die Entwicklungsphase von Kindern geht, ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung goldwert. In den hiesigen Supermärkten locken allerdings besonders an der Kasse immer wieder zahlreiche zuckerreiche Verlockungen, die durch ihre besonders kreativen Verpackungen auf sich aufmerksam machen. Eine Studie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn kommt […]
Noch diskutiert die Wissenschaft darüber, warum sich die Menschen so gerne küssen. Worüber man sich aber im Klaren ist, ist der gesundheitliche Nutzen. Denn Küssen ist mehr als eine der schönsten Nebensachen der Welt. Zwar stehen die gesundheitlichen Vorteile des Küssens nicht im Mittelpunkt der Forschung, der Wert ist aber unbestritten. Daneben gibt es weitere […]
Bei jungen Erwachsenen, die während ihrer Kindheit unter Mobbing litten, treten wesentlich häufiger psychische Probleme auf als unter ihren Altersgenossen, die als Kind von erwachsenen Personen körperlich misshandelt wurden. Psychische Folgen von Mobbing Von den gravierenden Folgen von Mobbing berichteten jetzt Psychologen aus Großbritannien und den USA auf der Jahrestagung der „Pediatric Academic Societies“ in […]
In heutiger Zeit heißt es in den hiesigen Unternehmen immer wieder, dass man sich „anbieten“ solle, proaktiv auftreten solle, weil die Lauteren schneller und öfter gehört werden und ein großes soziales Netzwerk in der heutigen Zeit unerlässlich ist. Psychologen und Ökonomen bekräftigen nun die Rolle der Introvertierten oder auch Stillen, wie ein Drittel unserer Gesellschaft […]
Nachahmung lässt sich auf sozialer Ebene tagtäglich beobachten. Kommen neue Trends auf, sieht man sie an jeder Straßenecke. Wir Menschen wollen demnach haben, was Anderen gefällt und was uns wiederum an Anderen gefällt. Die University of Chicago Booth School of Business führte zu diesem Thema sechs Experimente durch und deckt interessante Ergebnisse auf. Das Experiment […]
Unter Alkohol hat sich schon so manches Gemüt drastisch verändert. Enthemmung ist das Stichwort schlechthin. Doch wie kommt es eigentlich, dass manch einer unter Alkoholeinfluss extrovertierter wird, ein Anderer geradezu einschläft? Das haben sich Forscher auch gefragt und anhand zahlreicher Daten vier unterschiedliche Typen ermittelt, wie sie nur auftreten, wenn zu viel ins Glas geguckt […]
Die Kindheit wird im Rückblick als etwas Wunderbares betrachtet. Und eine mit Geschwistern verbrachte Kindheit bleibt als lebenslanges Band erhalten. Im Guten wie im Schlechten. Die Beziehung zu den Geschwistern gilt als die längste Beziehung unseres Lebens. Sie kann nicht beendet werden, sondern wirkt unterschwellig immer fort. Auch dann noch, wenn der Kontakt zu den […]
Menschen lügen in der Regel häufiger im Verlauf ihres Lebens. Es kommen Situationen auf, in denen wir keinen anderen Ausweg mehr sehen und zu einer kleinen Notlüge greifen. Gleichsam gibt es Menschen, die viel häufiger lügen, als es von außen betrachtet nötig erscheint. Hierbei handelt es sich dann nicht mal unbedingt nur um eine Notlüge. […]
Egal, wie geübt der Lügner ist – es gibt Signale, die ihn eindeutig überführen können. Dabei muss es sich nicht um schwere Lügen handeln, denn alleine im Alltag lügen Menschen bis zu 40 Mal am Tag. Meistens sind schon die ersten zehn Minuten eines Kennenlernens voll mit Unwahrheiten. Mittlerweile gibt es eine Reihe an Experten, […]
Ausgestreckte Arme, weit aufgerissene Augen, steifes Herumstaksen und dann – nach einiger Zeit – kehrt er unversehrt wieder ins Bett zurück um weiterzuschlafen dann am nächsten Tag nichts mehr von seinem nächtlichen Ausflug zu wissen. Etwa fünf Prozent der Erwachsenen sind somnambul. Sie sind Schlafwandler. Oft wird der Somnambulismus gleich gesetzt mit der Mondsucht, dem […]
Gruppenzwang ist ein Mechanismus, der so manchen Kindern und auch Erwachsenen zum Verhängnis werden kann. Ob im Fall von Mutproben, illegalen Aktivitäten oder dem Schule schwänzen – ergeben wir uns dem Gruppenzwang, dann handeln wir meist unseren eigenen Wertmaßstäbchen zu wider. Psychologen haben nun herausgefunden, dass Gruppenzwang zwar funktioniert, aber bereits nach wenigen Tagen schon […]
Introvertierte Menschen gelten als nachdenklich, in sich gekehrt und meist auch melancholisch. Dass es ihnen nicht beliebt in großen Menschenmassen aufzutreten oder vor ihnen zu sprechen, legt ihr Naturell bereits nahe. Eine Studie der Psychologin Shige Oishi von der University of Virginia beweist nun, dass introvertierte Menschen sich gerne in den Bergen aufhalten, während Extrovertierte […]
Dieser Tage werden wieder die Forderungen nach der Abschaffung von Sommer- respektive Winterzeit laut. Der Bioryhthmus werde gestört, es sei kein erkennbarer Nutzen vorhanden und zahlreiche weitere Argumente finden sich gegen die Einteilung der zwei Zeiten. Ökonomen der Universität Erlangen-Nürnberg haben nun in einer Studie herausgefunden, dass in Folge der Umstellung auf Sommerzeit die Lebenszufriedenheit […]
Nach einem Streit sind die Gemüter meist erhitzt und ein klärendes Gespräch ist nicht sogleich möglich. Wenn man sich verletzt, beleidigt oder im Wert herab gestuft fühlt, dann kann eine Entschuldigung fast als einziges Mittel dienen, um die Situation zu beruhigen. Wieso ist es eigentlich so, dass eine Entschuldigung so viel wiegt? Amerikanische Forscher haben […]