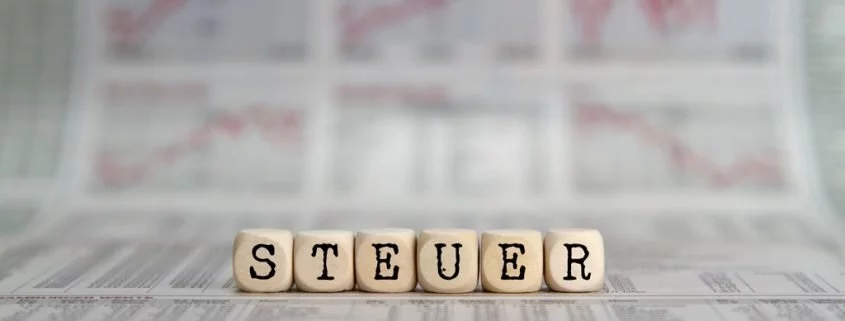Über zwei Milliarden Menschen leiden weltweit an Übergewicht. Die häufigsten gesundheitlichen Auswirkungen sind hierbei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes. Abgesehen von zu wenig Bewegung ist die häufigste Ursache dafür eine ungesunde Ernährung. In Dänemark gab es daher im Jahr 2011 eine Fettsteuer. Die Dänen mussten ungefähr 2,14 Euro mehr zahlen pro Kilo Öl, Fleisch oder Milchprodukte, […]
Archiv für die Kategorie: News & Storys
Du bist hier: Home » News & Storys » Seite 12
Ernährung News & Storys
Die größte Tierklonfabrik der Welt entsteht in China. In keinem anderen Land liegen Armut und wachsender Wohlstand so nah beieinander wie in China. Insgesamt führt der wirtschaftliche Erfolg dazu, dass es den Menschen besser geht. Der Fleischbedarf steigt immer mehr und es wird weniger Reis und Kohl gegessen. Um der enormen Nachfrage nachzukommen möchte ein […]
Matsutake-Pilze gehören zu den teuersten Lebensmitteln. Für 1 Kilogramm Matsutake-Pilze zahlt man 2000 Euro. Für Vegetarier gelten Pilze oft als Fleischersatz. 200 von den über 700 Pilzarten auf der Welt sind essbar. Der Herkunftsort und die Holzart auf der die Pize wachsen sind dabei für den Geschmack entscheidend. Inhaltsstoffe Pilze bestehen hauptsächlich aus Wasser (90%) […]
Ein Liter Milch für nicht mal einen Euro: Für den Verbraucher klingt das zunächst toll, aber die Folgen für die deutschen Milchbauern werden dabei nicht berücksichtigt. Wenn die Milch so günstig im Supermarkt angeboten wird, bekommen die Milchbauern gerade 20 Cent für den Liter und damit können sie nicht mehr wirtschaftlich produzieren. Um die so […]
Ist der Mozzarella locker und leicht? Schmeckt er etwas salzig? Stiftung Warentest hat 20 verschiedene Mozzarella-Sorten getestet und kam dabei zu einem überraschenden Ergebnis. Ob auf der Pizza, mit Tomaten und Basilikum oder im Salat, Mozzarella ist bei den Deutschen sehr beliebt. Stiftung Warentest hat nun 20 verschiedene Mozzarella-Käsesorten untersucht, darunter befanden sich auf 4 […]
Fast jeder hat das schon erlebt, plötzlich schwirren Dutzende von winzigen Fruchtfliegen durch die Küche und sitzen auf allen Früchten. Viele ekeln sich vor den kleinen Fliegen und werfen befallenes Obst aus Sorge um ihre Gesundheit weg. Dabei stellen die Fliegen keine Gefahr für die Gesundheit dar. Und selbst wenn eine ihrer Larven mitgegessen wird, […]
Über eine Zuckersteuer wird schon länger in vielen Ländern diskutiert, doch in England sollen nun Nägel mit Köpfen gemacht werden. Sie wollen ab 2018 eine Zuckersteuer einführen, die sich allerdings nur auf zuckerhaltige Getränke bezieht. Nach dem Bekanntwerden dieser Entscheidung wurde die Diskussion neu entfacht. So bleiben Schokolade, Gummibärchen und Co. zumindest vorerst von den […]
Betrachtet man es ganz nüchtern, ist Molke eigentlich lediglich ein Abfallprodukt der Käseherstellung und nichts, was gezielt hergestellt wird. Diese nährstoffreiche Flüssigkeit allerdings einfach wegzuschütten, bloß weil es nicht das Produkt ist, was hergestellt werden sollte, wäre allerdings Verschwendung. Glücklicherweise haben wir schon lange erkannt, dass Molke wertvoll für unsere Ernährung sein kann und verwenden […]
Pastrami ist eine vermeintlich neue Delikatesse aus den USA, die ein einfaches Sandwich zu einem ganz besonderen Imbiss werden lässt. Auch in Deutschland erfreut sich das lange haltbare Rindfleisch immer größerer Beliebtheit, obwohl es nicht immer ganz einfach zu finden ist. Besonders wer die amerikanische Spezialität zu Hause genießen will, muss mitunter etwas suchen, da […]
Butter, so predigen es die Ernährungswissenschaftler und Mediziner, ist Gift für unseren Körper und vor allem unser Herz. Butter zählt zu den gesättigten Fettsäuren, aus denen wir nicht mehr als zehn Prozent unserer Energie gewinnen sollten. Besser und gesundheitsfreundlicher sind hingegen die ungesättigten Fettsäuren, welche sich in Oliven-, Raps- und Sonnenblumenöl verbergen. Diese ungesättigten Fettsäuren […]