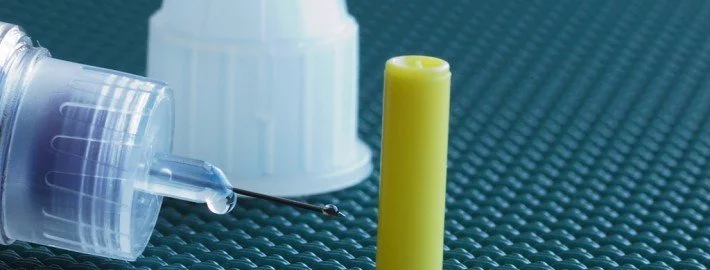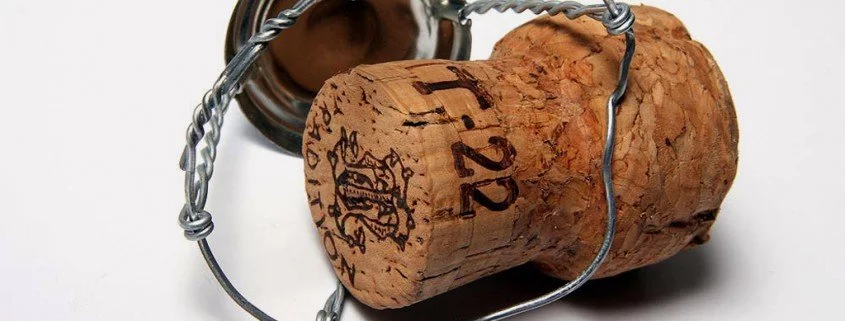Wenn man den Begriff „Essstörung“ hört, tauchen bei den meisten Menschen stereotypische Bilder vor dem inneren Auge auf: Ein abgemagertes Mädchen, dass Salatblätter abwiegt oder mit dem Finger im Hals vor einer Toilette kauert. Sicherlich sind diese Assoziationen berechtigt, doch zieht mittlerweile noch eine weitere Essstörung in die Köpfe der Industriestaatler ein – die Orthorexia […]
Archiv für die Kategorie: Krankheitsbilder
Du bist hier: Home » Krankheitsbilder » Seite 15
Gesundheit Krankheitsbilder
Jennifer Schermann verstarb mit 20 Jahren an einer Herzmuskelentzündung. Diese Meldung ging in den vergangenen Tagen durch die Medien. Bei der Entzündung des Herzens handelt es sich keineswegs um eine seltene Erscheinung. In den meisten Fällen verlaufen die Erkrankungen allerdings symptomlos, sodass sie nur selten lebensbedrohlich werden. Was ist die Herzmuskelentzündung? Herzmuskelentzündungen können durch verschiedene […]
Dass sich die Psyche auch über Umwege auf den Körper auswirken kann, ist bereits bekannt. Nach Trennungen kann sich der Stresspegel beispielswiese deutlich erhöhen, was eine erhöhte Herzaktiviät verursacht. Ein relativ unbekanntes Phänomen, das durch diese Umstände entstehen kann, ist das Broken Heart Syndrom. Ursachen und Vermutungen Wie verbreitet das Broken-Heart-Syndrom ist, konnte bislang nicht […]
Das Krankheitsbild Tinnitus ist weit verbreitet. Die Ohrgeräusche belasten die Betroffenen stark. Die Pfeif-, Quitsch- und Zischtöne im Kopf lassen sich nicht abstellen, sodass sie nahezu 24 Stunden am Tag präsent sind. Doch was ist der Tinnitus eigentlich und wie entsteht er? Tinnitusarten Grundsätzlich muss ein akuter von einem chronischen Tinnitus unterschieden werden. Der akute […]
Bluthochdruck ist in Deutschland weit verbreitet. Niedriger Blutdruck (Hypotonie) hingegen ist weit seltener zu finden. Allerdings verursacht auch er lästige Symptome, die behandelt werden müssen. Eine schlimme Erkrankung ist der niedrige Blutdruck allerdings nicht. Zudem lässt er sich gut behandeln und ein großer Behandlungsaufwand ist nicht notwendig. Menschen mit niedrigem Blutdruck leiden in der Regel unter […]
Mittelohrentzündung ist besonders bei Kindern weit verbreitet. Die schmerzhaften Entzündungen werden in der Regel mit Schmerzstillern behandelt und auch gegen die Entzündung selbst werden Medikamente verabreicht. Es gibt allerdings auch altbewährte Hausmittel, die noch heute zahlreich eingesetzt werden und die Erkrankung günstig beeinflussen sollen. Die Zwiebel bietet hier ein Paradebeispiel als Hausmittel! Was ist eine […]
Alleine in Europa sind derzeit über 50 Millionen Menschen wegen Diabetes in Behandlung. Die Zahl der Betroffenen steigt stetig an. Und doch sind viele Mythen über die Krankheit im Umlauf, die auch das Verhalten der Diabetiker selbst beeinflussen. Diabetes ist eine Erkrankung, die noch immer von Irrtümern und Vorurteilen geprägt ist. Nicht immer muss der […]
Alkoholabhängigkeit oder die Sucht nach Alkohol sind weit verbreitet. Daneben gibt es aber auch den einfachen schädlichen Gebrauch, der ohne eine Abhängigkeit verläuft. Die Übergänge zwischen beiden Varianten sind häufig fließend und nicht immer ist direkt ersichtlich, ob eine Person bereits süchtig ist oder ein schädlicher Gebrauch vorliegt. Und sehr häufig sind die Übergänge nicht […]
Alkoholismus: Eine Erkrankung mit vielen Ursachen. Bereits die Entstehung ist ein Phänomen, das häufig Unverständnis auslöst. Die Krankheit kann allerdings nahezu jeden betreffen. Es kommt auf die Umstände an, die individuell unterschiedlich sind. Nicht immer kann ein Betroffener der Sucht ausweichen. Die Ursachen des Alkoholismus sind bei jedem Menschen mindestens einmal im Leben vorhanden und […]
Alkoholismus ist ein Problem mit Langzeitfolgen – dieser Umstand ist allgemein bekannt. Die Ursachen für die Problematik sind vielfältig und beginnen bei den Genen und führen über die gesellschaftlichen Einflüsse bis hin zu individuellen Faktoren. Dennoch schreckt Alkohol die Menschen nicht ab und der Alkoholismus breitet sich aus – mit allen Langzeitfolgen. Schon der erste […]