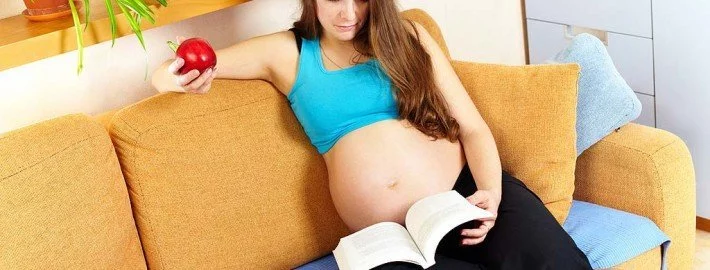In Deutschland genießen werdende Mütter ein paar Privilegien, um die sie ihre Schwestern in anderen Ländern beneiden könnten. Denn Sie werden durch die im Gesundheitssystem integrierte Maßnahme der Schwangerschaftsvorsorge auf dem gesamten Weg der Schwangerschaft, Geburt und auch noch nach der Geburt mit bestem medizinischen Know How untersucht und beraten. Der „Mutterpass“ füllt sich so […]
Schlagwortarchiv für: Schwangerschaft
Du bist hier: Home » Schwangerschaft » Seite 6
Beiträge
Wadenkrämpfe sind keine Seltenheit. Vor allem Sportler, ältere Menschen oder Schwangere leiden oftmals darunter. Und wenn diese Krämpfe dann auch noch nachts auftreten, wird es besonders fies. Geraten wird einem dann häufig zur zusätzlichen Einnahme von Magnesiumpräparaten. Doch hilft Magnesium bei Wadenkrämpfen überhaupt? Die Ursachen von Wadenkrämpfen Die Ursachen für Krämpfe können vielfältig sein. Beispielsweise […]
Meist kennen wir nur die Tipps für werdende Mütter, sich besonders gesund zu ernähren. Doch auch was der Vater isst, kann einen großen Einfluss auf den Nachwuchs haben. Informationen zur Steuerung des Appetits können über unsere Gene vererbt werden. Stellt der Vater also vor der Zeugung des Kindes seine Ernährung um, kann er damit die […]
Auch wenn es ein schwacher Trost ist: Übelkeit in der Schwangerschaft verschwindet meistens nach den ersten drei Monaten. Diese müssen aber erst einmal durchgestanden werden und damit das leichter fällt, gibt es anschließend ein paar Tipps. Zunächst aber soll darauf hingewiesen werden, dass bei starkem Erbrechen während der Schwangerschaft (Hyperemesis Gravidarum) unbedingt ein Arzt aufgesucht […]
Reifere Frauen, bei denen eine Schwangerschaft festgestellt wird, müssen sich einigen Früherkennungsuntersuchungen unterziehen. Heute sind aufschlussreiche Untersuchungsverfahren möglich, für die nicht einmal die Entnahme von Fruchtwasser erforderlich ist, was das Risiko einer Fehlgeburt mit sich bringt. Ein Blutentnahme bei der Schwangeren ist die Basis für die nicht-invasiven Pränataltests, auch NIPT genannt. Mediziner können aus dieser Blutprobe […]
Die Schwangerschaft ist in jeder Hinsicht eine besondere Phase im Leben einer Frau. Diese kann auch durch Beschwerden wie Morgenübelkeit, Rückenschmerzen und ähnliche Symptome begleitet sein. Die Frage stellt sich nun, welche Schmerzmittel schwangere Frauen einnehmen dürfen und von welchen Mediziner abraten. Im Folgenden haben wir unser diese Frage mal genauer angesehen. Tatsächlich betrifft dies […]
Nach der Schwangerschaft fühlen sich viele Frauen nicht richtig wohl mit ihrem Körper. Er wurde durch die Schwangerschaft stark beansprucht und durch die zusätzlichen Nährstoffe, die zur Versorgung des Ungeborenen aufgenommen werden müssen, hat sich die Figur verändert. Vielen wollen deshalb an ihrer Fitness arbeiten – aber welcher Sport ist nach der Schwangerschaft angesagt? Schließlich […]
Eine neue Kaiserschnittmethode sorgt dieser Tage für Furore in den Medien. In Bad Oeynhausen, einem Ort in Nordrhein-Westfalen, hatte eine Mutter nach einem Kaiserschnitt ihr Kind selbst aus ihrem Bauch gezogen. Inzwischen wird etwa jede dritte Geburt per Kaiserschnitt vorgenommen. Diese Operation ist demnach inzwischen zum Krankenhausalltag geworden. Wie sieht es aber mit assistierenden Müttern […]
Die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland steigt kontinuierlich an. Laut neuster Erhebungen sind mehr als die Hälfte der deutschen Frauen übergewichtig. Dass sich diese Tatsache auf alle Lebenslagen auswirkt, ist zu erwarten. Eine schwedische Studie hat sich nun zur Aufgabe gemacht die Auswirkungen für Neugeborene von übergewichtigen Müttern eruiert. Verschiedene Studien deuten bereits daraufhin, […]
Wer kennt das nicht? Das Baby wirft den Schnuller auf den Boden, die Mutter leckt diesen kurz sauber und schon ist das Kind wieder zufrieden. Viele Leute vermuten, dass durch eine solche Aktion Karies auf das Kind übertragen werden kann. Ist an dieser Vermutung etwas Wahres? Tatsache ist, dass durch Speichel durchaus Bakterien weitergegeben werden […]