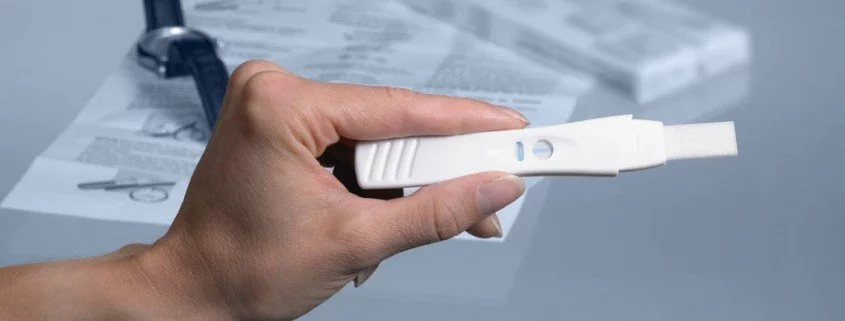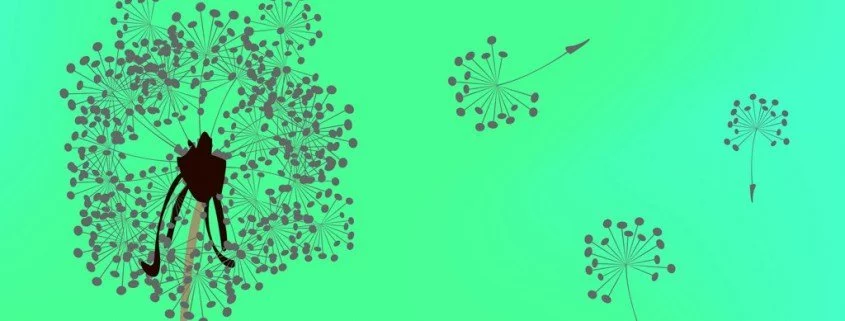Mutter sein ist ein Vollzeitjob. Das ist nicht nur Müttern, sondern auch der Allgemeinheit bekannt und doch: Der Stress und die Belastung, die mit dieser Tatsache einher gehen werden immer noch weitesgehend unterschätzt. Die neue Forsa-Umfrage der DAK-Gesundheit hat sich diesem Thema nun angenommen und insgesamt 1003 Frauen kurz vor dem Muttertag nach ihrer Meinung […]
Schlagwortarchiv für: Schwangerschaft
Du bist hier: Home » Schwangerschaft » Seite 3
Beiträge
Ein Kind zu bekommen, stellt für viele Paare einen großen Wunsch dar. Geht dieser dann nicht in Erfüllung, ist das für das Paar eine große psychische Belastung. In Europa bekommen etwa ein bis zwei Prozent der Frauen im Alter von 20 bis 44 Jahren kein erstes Kind. Und etwa zehn Prozent der Frauen, die bereits […]
Nicht wenige Frauen beschäftigen sich bereits mit Anfang 20 mit der Frage nach dem „perfekten“ Zeitpunkt dafür Mutter zu werden. Meistens kommen dann Karriere, Studium oder andere Dinge erst einmal dazwischen und mit voranschreitendem Alter wird es stets unwahrscheinlicher Mutter zu werden. Trotzdem lässt sich kein allgemeingültiges Alter festlegen, ab dem es für eine Frau […]
Erst kürzlich wurde in Göteborg die erste Gebärmuttertransplantation vorgenommen. Es handelte sich dabei um die Verpflanzung von der Mutter auf die Tochter. Es war die erste Operation dieser Art und die Planung dauerte knapp drei Jahre. Derzeit werden vor allem ethische Bedenken diskutiert. Ethische Bedenken und Risiken Grundsätzlich sind an der Transplantation nicht nur die […]
Vor und Nachteile von “natürlicher” Geburt und Kaiserschnitt In der westlichen Gesellschaft, in der die Gleichberechtigung und Emanzipation der Frau groß geschrieben werden, gibt es einen neuen Trend: Den Wunschkaiserschnitt. Die meisten Frauen informieren sich zielgerichtet schon vor oder während ihrer Schwangerschaft über mögliche Geburtswege und deren Risiken und Vorteile. Was unter Berücksichtigung der persönlichen […]
Bis vor wenigen Jahrzehnten war die Geburt in den eigenen vier Wänden ganz normal. Der Frau zur Seite wurde eine Hebamme gestellt und der Arzt trat nur dann in Erscheinung, wenn es zu Komplikationen kam. Heute ist das ganz anders, die Geburt im Krankenhaus ist die Regel und das, obwohl die meisten Frauen sich zuhause sehr viel wohler fühlen […]
„Dieses Baby ist wirklich zum Knuddeln“, eine Aussage, die wohl die meisten kennen, wenn es um Säuglinge geht. Doch unter Umständen ist Vorsicht geboten, denn eine Knuddelattacke kann für den Säugling eine lebensbedrohliche Gefahr darstellen. In diesem Fall ist nicht die Rede davon, dass der Erwachsene zu fest drückt und dem Baby so schadet, sondern […]
Vor gar nicht allzu langer Zeit war es undenkbar als HIV-Infizierte Mutter ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Ärzte und Angehörige rieten in diesen Fällen oft zur Abtreibung. Heutzutage ist die Medizin schon so weit, dass HIV-Inifizierte Mütter gesunde Babys gebären können und zudem oftmals ein langes Leben vor sich haben. Die gesellschaftliche […]
Die Schwangerschaft ist eine Zeit voller Veränderungen. Die Partnerschaft stellt sich auf das neue Familienmitglied ein und auch die Mutter spürt, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Mit der Schwangerschaft kommt es auch zu einer Umstellung des Körpers der Mutter, der verschiedenen Beschwerden ausgesetzt ist. Homöopathie kann einen Beitrag dazu leisten die Probleme zu minimieren und […]
Die Vorbereitung auf die Geburt des eigenen Kindes kann nicht ausgiebig genug erfolgen. Ob Atemtechniken, Ruheübungen oder andere Methoden – werdende Mütter sind froh über jede Möglichkeit die Entbindung so schmerzfrei wie möglich zu absolvieren. Frauenärzte und Hebammen entdecken aktuell die Hypnose als Möglichkeit Ängste während der Entbindung zu mindern und Schmerzen zu lindern. Tatsächlich […]