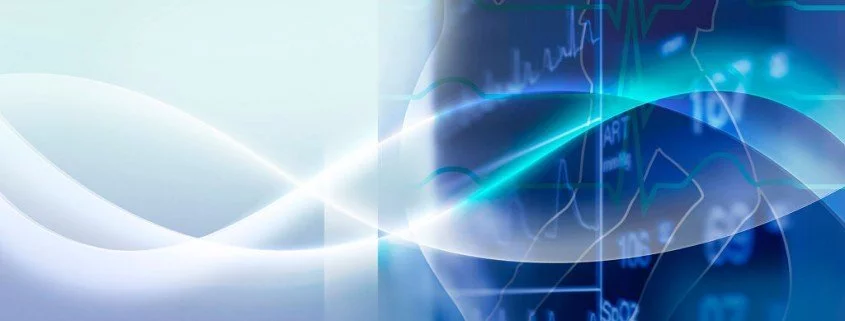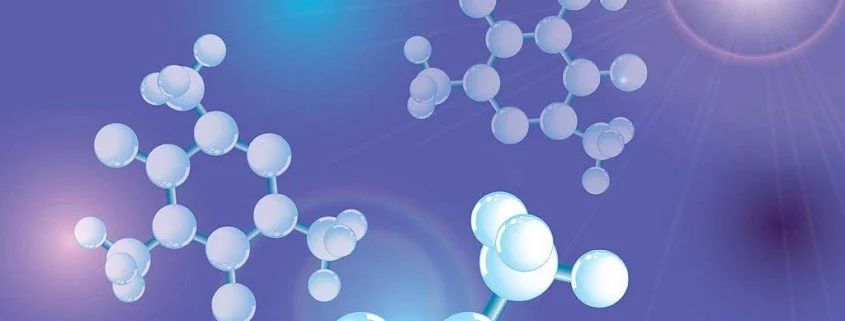Sie sind zwar zum Mond geflogen, müssen jetzt aber scheinbar einen hohen Preis dafür bezahlen. Scheinbar leiden Astronauten häufig nach einer Exkursion an Herzkrankheiten. Das Risiko für Erkrankungen ist nicht für alle Astronauten gleich groß. Die Astronauten, die Reisen in das All unternehmen, leiden wohl an einem höheren Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, als diejenigen, […]
Schlagwortarchiv für: Herz
Du bist hier: Home » Herz
Beiträge
Der Herzinfarkt, im medizinischen Fachjargon auch Myokardininfarkt genannt, ist inzwischen zur Volkskrankheit geworden. Der Forscher Kiran Munsunuru will sich nun einer Methode bedienen, die Herzinfarkte möglicherweise sogar verhindern kann. Die Technik ist nobelpreisverdächtig und so ihre beiden Entdeckerinnen. Crispr/Cas9 Der Stammzellenforscher Munsunuru bedient sich eines gentechnischen Verfahrens mit dem komplizierten Namen Crispr/Cas9. Die Erwartung an […]
Immer mehr Menschen leiden an Herzkrankheiten. Diese Tatsache hat sich ein Hamburger Start-Up Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen genommen und stellt nun den 24-Stunden-Kardiologen vor. Diese Erfindung soll dafür sorgen, dass ein Patient, der an akuten oder auch weniger akuten Herzproblemen leidet, in der Lage ist einen Kardiologen rund um die Uhr […]
Was kann mit einer Herzkatheter- Untersuchung erreicht werden? Durch eine Herzkatheter-Untersuchung kann beispielsweise der Druck in den Herzkammern gemessen werden. Dadurch können zum Beispiel Herzklappenfehler oder auch eine Verengung in den Herzkranzgefäßen festgestellt werden. Wird eine Engstelle festgestellt, so kann der Arzt diese meist sofort bei dem Eingriff entfernen. Verschiedene Arten der Herzkatheter- Untersuchung Es […]
Jennifer Schermann verstarb mit 20 Jahren an einer Herzmuskelentzündung. Diese Meldung ging in den vergangenen Tagen durch die Medien. Bei der Entzündung des Herzens handelt es sich keineswegs um eine seltene Erscheinung. In den meisten Fällen verlaufen die Erkrankungen allerdings symptomlos, sodass sie nur selten lebensbedrohlich werden. Was ist die Herzmuskelentzündung? Herzmuskelentzündungen können durch verschiedene […]
Ein Buch von Marcel Reich-Ranicki trägt den Titel „Herz, Arzt und Literatur“. In seinem langen und bewegten Leben hatte der bekannteste deutsche Kritiker es nicht nur mit Literatur, sondern auch mit Herz-Beschwerden und Fach-Ärzten zu tun. Was ist der plötzliche Herztod? Vielleicht hätten wir die Bereicherung, die diese Person für die deutsche Kulturlandschaft darstellte, noch länger genießen können, […]
Das Bostoner Kinderkrankenhaus hat erstmals Mikropartikel erzeugt, die direkt in die Blutbahn injiziert werden können. Es handelt sich dabei um Sauerstoff, der die Versorgung sicherstellt, auch wenn der Patient selbst nicht mehr atmen kann. Damit gelang den Medizinern ein wichtiger Durchbruch in der Notfallmedizin, denn diese Technik ermöglicht die Rettung von Millionen Patienten, die aufgrund […]
Volkskrankheit Herzinfarkt. Fast jeder von uns hat einen Bekannten oder ein Familienmitglied, der schon einmal einen akuten Herzanfall durchleiden musste. Und eines ist klar: Ist es erst einmal so weit gekommen, zählt jede Minute. Folgeschäden an Körper und Seele sind meist die Folge und können tatsächlich nur durch ein Mittel vermieden werden: Die Herzinfarkt-Prävention. Der […]
Trainieren statt schonen – leben mit einer Herzmuskelschwäche Hieß es noch in der Vergangenheit, dass Personen, die an einer Herzmuskelschwäche leiden, ein ruhiges Leben führen sollen, wurden nun neue Erkenntnisse bekannt. Mit einem gezielten Training können die Überlebenschancen für Betroffene deutlich erhöht werden. Manchmal kann eine Grippe zu einer Herzmuskelentzündung führen. Zunächst verschwinden zwar die akuten Symptome […]
Immer wieder kommt es vor, dass vor allem ältere, aber auch junge Menschen, die noch in der vollen Blüte ihres Lebens stehen, bei körperlichen Arbeiten recht schnell niedergeschlagen und erschöpft sind. Grund könnte natürlich einfach nur eine unzureichende Ausdauer sein. Möglich wäre aber auch ein schwaches Herz. Doch woher weiß man nun eigentlich, ob man einfach […]