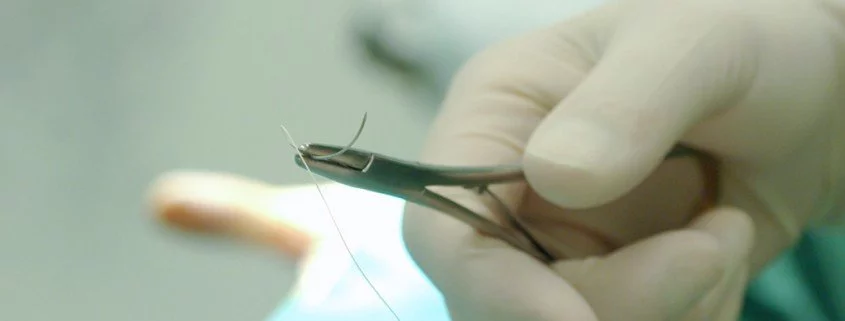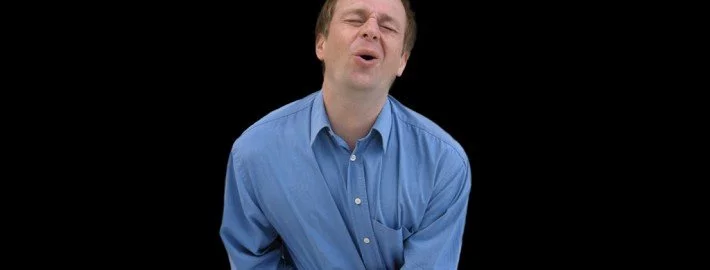Schüßler Salze stellen mittlerweile seit über 120 Jahren eine Methode der Alternativmedizin dar. Einfach selbst angewendet, können sie bei verschiedenen Symptomen Abhilfe schaffen. Doch was viele nicht wissen: Neben der Einnahme der Salze oder der Anwendung von Salben können auch temperaturansteigende Fußbäder die Behandlung unterstützen. Wie wirken temperaturansteigende Bäder? Zwar hat sich Dr. Schüßler selbst […]
Schlagwortarchiv für: Behandlung
Du bist hier: Home » Behandlung
Beiträge
Dieser Tage geistern durch die Medien zahlreiche Berichte von Behandlungsfehlern im OP, im Krankenhaus oder auch beim Allgemeinmediziner in der Praxis. 12000 Beschwerden gingen allein 2013 bei der Bundesärztekammer wegen möglicher Behandlungsfehler ein. In 2200 Fällen bekamen die Klagenden recht. Das sind erschreckende Zahlen, die uns auch zu der Frage führen: Welche Rechte haben Patienten […]
Erektionsstörungen sind ein weitverbreitetes, häufig aber todgeschwiegenes Thema. Eine Veränderung brachte die blaue Tablette Viagra. Jetzt lief der Patentschutz aus. Ein Dutzend anderer Hersteller haben Generika auf den Markt gebracht. Also eine Kopie von Viagra mit demselben Wirkstoff Sildenafil und zu einem wesentlich günstigeren Preis. Zudem gibt es natürlich noch andere Produkte zu kaufen. Aber […]
Mit dem schönen Wetter kommen auch wieder allerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen auf uns zu: von Allergieerscheinigungen bis zu Zeckenbissen ist auch dieses Jahr wieder Alles vertreten. Eine besonders beachtenswerte Form der Zeckenbisse löst die Frühsommer-Meningoenzephalitis aus. Zunächst sei zu erwähnen, dass nicht jeder Mensch, der von einer Zecke gebissen wird, an FSME erkrankt. In 70 bis […]
Bereits seit Juni diesen Jahres dürfen Ärzte im Bundesland Baden-Württemberg ihre Patienten auch per Telefon oder über das Internet beraten. Auch in Hessen setzt sich die Techniker Krankenkasse jetzt dafür ein, das bestehende Verbot für Fernbehandlungen aufzuheben. Videobotschaft vom Arzt In Zukunft sollen Patienten per Video mit ihrem Arzt kommunizieren können, Beratungen sollen telefonisch durchgeführt […]
Wenn es nach dem Essen im Oberbauch drückt und zwickt, Übelkeit bis zum Erbrechen auftritt oder es zu Durchfällen kommt, könnten auch Gallensteine dahinterstecken. Diese Frage sollte unbedingt ärztlich abgeklärt werden, denn Gallensteine können auch Komplikationen verursachen – müssen sie aber nicht! Die meisten Menschen spüren ein ganzes Leben lang nichts davon, dass sie Gallensteine […]
Im allgemeinen Sprachgebrauch nur als sogenannte Bluterkrankheit bekannt, stellt die Hämophilie eine Störung der Blutgerinnung dar. Es gerinnt deutlich langsamer als bei anderen Menschen. Zum einen heilen Wunden langsamer, zum anderen kann es auch im Inneren des Körpers zu Blutungen kommen, beispielsweise durch einen Sturz. Häufigkeit einer Hämophilie Bei der Hämophilie wird zwischen mehreren Formen […]
Allergien sind auf dem Vormarsch. Besonders im Sommer erwischt es viele Menschen, einige davon das erste Mal. Die Auslöser für eine Allergie, die sich in den Atemwegen bemerkbar macht, können Pollen, Tierhaare oder Hausstaub sein. Die beste Vorbeugung gegen Allergien ist es, wenn man den Auslösern aus dem Weg geht. Es kann zwar nicht ganz […]
Obwohl ca. 50 Prozent der Bevölkerung in unterschiedlicher Ausprägung unter Hämorrhoiden leiden, wird über diese Thematik selten in der Öffentlichkeit gesprochen. Viele Betroffene scheuen sogar den Weg zum Arzt oder in die Apotheke, weil es ihnen unangenehm ist, Brennen und Jucken im Analbereich zu beschreiben. Dabei gibt es recht erfolgreiche Methoden, durch welche die Begleiterscheinungen […]
Hitzebehandlung gegen Krebs Die Diagnose Krebs ist erschütternd. Sie zerstört Leben und kann Hoffnung rauben. Wie müssen sich dann erst jene Patienten fühlen, die an unheilbarem Krebs erkrankt sind? Bei denen weder Chemotherapie und Operationen mehr helfen – die als „austherapiert“ gelten? Man kann es sich gar nicht vorstellen. Und doch erscheint nun ein Silberstreif […]