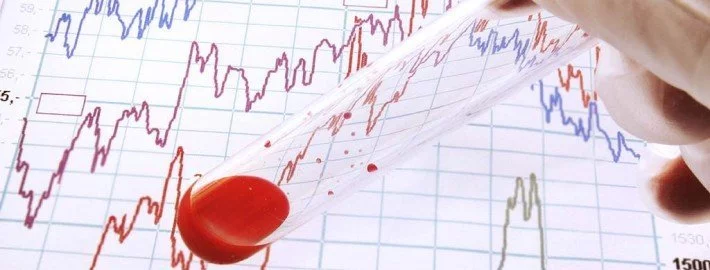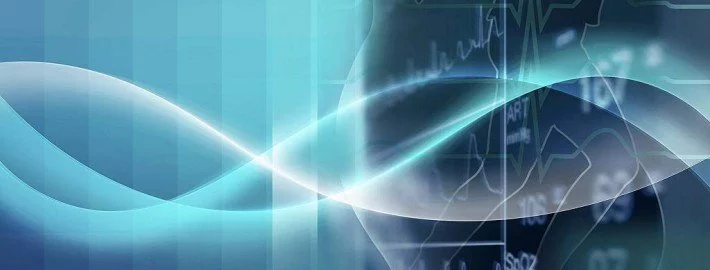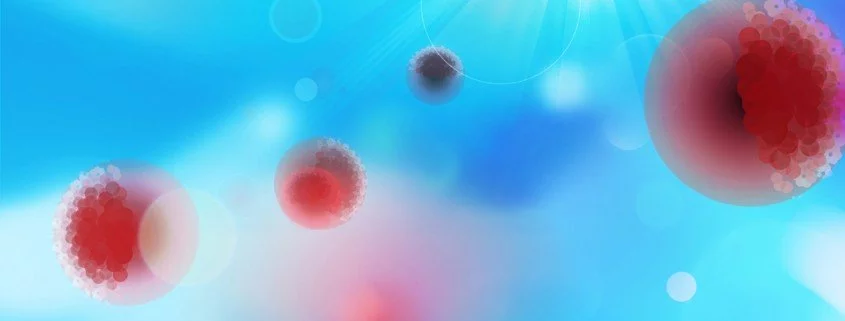Die Achillessehne (Tendo Calcaneus) ist die stärkste Sehne, die der menschliche Körper aufweist. Sie stellt die Verbindung zwischen dem Fersenknochen – dem sogenannten Fersenbein – und der Wadenmuskulatur dar. Die Sehne ist notwendig um zum Beispiel, auf den Zehenspitzen zu stehen sowie für das Abstoßen beim Laufen und beim Springen. Vom Riss der Achillessehne sind oft sportliche […]
Schlagwortarchiv für: Diagnose
Du bist hier: Home » Diagnose
Beiträge
Alkoholabhängigkeit oder die Sucht nach Alkohol sind weit verbreitet. Daneben gibt es aber auch den einfachen schädlichen Gebrauch, der ohne eine Abhängigkeit verläuft. Die Übergänge zwischen beiden Varianten sind häufig fließend und nicht immer ist direkt ersichtlich, ob eine Person bereits süchtig ist oder ein schädlicher Gebrauch vorliegt. Und sehr häufig sind die Übergänge nicht […]
Einen Schlaganfall zu erleiden, ist ein hartes Los, das das Leben des Betroffenen sowie seiner Angehörigen verändert. Ein Schlaganfall verursacht die Zerstörung von Hirngewebe. Dieses Absterben von Hirngewebe erfolgt durch eine unzulässige Blutzufuhr des Gehirns. Nerven sterben ab und je nachdem welche Gehirnhälfte stärker betroffen ist, leiden unterschiedliche Fähigkeiten darunter. Die Nachwirkungen respektive Folgen eines […]
Etwa 40 Millionen Mal wird in Deutschland pro Jahr ein Antibiotikum verschrieben. Dabei ist oftmals noch gar nicht sicher, ob es überhaupt helfen kann und wird. Antibiotika werden bei Infektionskrankheiten eingesetzt. Bei bakteriell verursachten Infekten wirken sie ebenfalls lindernd, nicht aber bei durch Viren verursachten Infekten. Bakterien und Viren können auf unterschiedliche Weise krank machen. Viren zerstören […]
Bei Chorea Huntington handelt es sich um eine Erkrankung des Gehirns, die vererbt wird. Das Gehirn wird über die Jahre hinweg schwer zerstört. Sowohl die Muskelsteuerung als auch psychische Funktionen sind davon betroffen. Das fehlerhafte Gen ist außerdem dafür verantwortlich, dass die Nervenzellen nach und nach absterben. Studien besagen, dass in Deutschland ungefähr 8.000 Menschen unter der […]
Wacht man morgens mit schwerwiegenden Kopfschmerzen auf, kann das mehrere Ursachen haben. Unter anderem kann die Kiefermuskulatur dafür verantwortlich sein. Dies kann mit einer Biss-Fehlstellung, auch Craniomandibulärer Dysfunktion genannt, zusammen hängen. Cranio bedeutet Schädel und Mandibula ist der Unterkiefer. CMD ist zunächst einmal ein Überbegriff für Störungen im Schädel und Unterkiefer. Damit werden Schmerzen im […]
Dass sich die Psyche auch über Umwege auf den Körper auswirken kann, ist bereits bekannt. Nach Trennungen kann sich der Stresspegel beispielswiese deutlich erhöhen, was eine erhöhte Herzaktiviät verursacht. Ein relativ unbekanntes Phänomen, das durch diese Umstände entstehen kann, ist das Broken Heart Syndrom. Ursachen und Vermutungen Wie verbreitet das Broken-Heart-Syndrom ist, konnte bislang nicht […]
Eine der wohl schlimmsten Nachrichten, die Ihr Arzt für Sie haben kann, ist die Diagnose Morbus Crohn. Tausende von Menschen in den Industrieländern leiden an dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung und müssen oft einem hohen Leidensdruck standhalten. Entstehung Über die Entstehung von Morbus Crohn sind sich die Mediziner bislang nicht einig. Es gibt einige plausible Erklärungsversuche, […]
Die Nieren übernehmen eine ganz wichtige Aufgabe für unseren menschlichen Organismus: sie filtern die Schadstoffe heraus. Versagt die Leistung der Nieren langsam, dann wird das relativ schnell durch eine zunehmend ungesunde Hautfarbe deutlich, die anzeigt, dass der Körper langsam vergiftet. Aus diesem Grund ist dieses Organ wichtiger als wir uns vielleicht eingestehen wollen. Versagen die […]
Sie können keine Unterhaltung führen, sie können kein Theater und auch kein Kino besuchen, sie bekommen Probleme bei der Arbeit und am Ende ziehen sie sich immer mehr in die soziale Isolation zurück: Menschen mit chronischem Husten leiden neben dem eigentlichen chronischen Husten unter einer massiven Einschränkung ihrer Lebensqualität. Die (psycho-)sozialen Folgen des chronischen Hustens […]