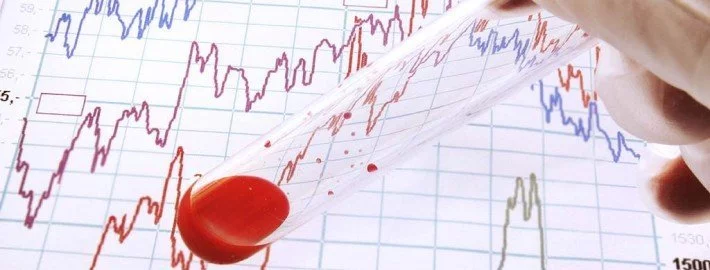Das Wundermittel Aspirin kennt jeder, der darin enthaltende Wirkstoff Acetylsalicylsäure kurz ASS genannt, gilt als der wirksamste Schmerzstiller überhaupt. Seit dem Jahr 1977 steht Aspirin auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO. Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure ist schon seit der Antike bekannt. Im alten Griechenland wurde der Saft aus Weidenrinde schon gegen Schmerzen und Fieber […]
Schlagwortarchiv für: Blut
Du bist hier: Home » Blut
Beiträge
Tagtäglich wird HES vielfach bei Infusionen nach Operationen benötigt. Es gibt bislang keine gängige Alternative. Trotzdem gilt es als nierenschädigend und wurde in Großbritannien vom Markt genommen. Das BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, legt deutschen Ärzten nahe, auf die gängige Infusionslösung HES zu verzichten. Was ist HES und wozu wird es gebraucht? HES steht als […]
Etwa 40 Millionen Mal wird in Deutschland pro Jahr ein Antibiotikum verschrieben. Dabei ist oftmals noch gar nicht sicher, ob es überhaupt helfen kann und wird. Antibiotika werden bei Infektionskrankheiten eingesetzt. Bei bakteriell verursachten Infekten wirken sie ebenfalls lindernd, nicht aber bei durch Viren verursachten Infekten. Bakterien und Viren können auf unterschiedliche Weise krank machen. Viren zerstören […]
Erschreckende Wissenslücken bei der Brustkrebs-Vorsorge Diagnose Brustkrebs – etwa 75.000 Frauen erkranken jährlich in Deutschland an dem bösartigen Tumor. Meist betrifft es Frauen zwischen 50 und 70. 2010 starben über 17.500 Frauen daran. Etwa 100.000 Brustentfernungen wurden im Jahr 2011 durchgeführt. Wie sehen die Heilungschancen aus? Brustkrebs – früh diagnostiziert – ist durchaus heilbar. Wenn der Tumor […]