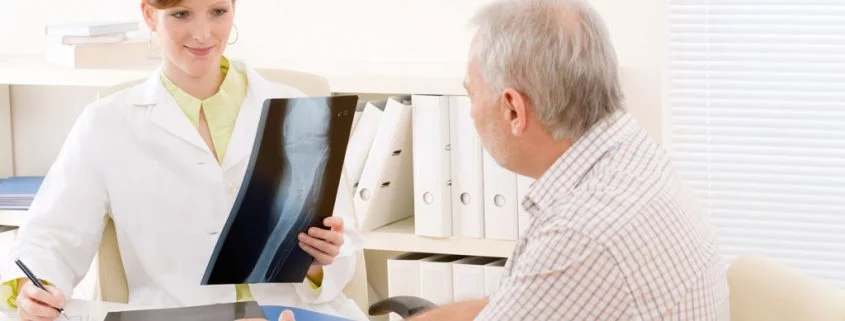Fasten ist bei den Deutschen sehr beliebt, mehr als die Hälfte hat es schon einmal probiert. Ernährungsmediziner warnen jedoch davor, dass viele Regeln zum Fasten auf veralteten Annahmen beruhen. Sehr viele Menschen verzichten in der Fastenzeit auf Schokolade, Alkohol oder Fleisch Ein solcher Verzicht kann durchaus sinnvoll sein, das Ess- und Trinkverhalten wird hinterfragt und […]
Archiv für die Kategorie: Therapie & Verfahren
Du bist hier: Home » Therapie & Verfahren » Seite 4
Gesundheit Therapie & Verfahren
Das Wundermittel Aspirin kennt jeder, der darin enthaltende Wirkstoff Acetylsalicylsäure kurz ASS genannt, gilt als der wirksamste Schmerzstiller überhaupt. Seit dem Jahr 1977 steht Aspirin auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO. Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure ist schon seit der Antike bekannt. Im alten Griechenland wurde der Saft aus Weidenrinde schon gegen Schmerzen und Fieber […]
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung fand heraus, dass in manchen Teilen Deutschlands achtmal so viele Mandel-OPs an Kindern durchgeführt werden, wie in anderen Regionen des Landes. Doch woran kann das liegen? Sind die Kinder in den betroffenen Regionen kränker als in anderen oder sollte es tatsächlich gravierende Unterschiede in der Kompetenz der behandelnden Ärzte geben? […]
Der Arzt verschreibt ein Medikament und man nimmt es nach Anweisung – so schnell und simpel ist der Vorgang erklärt, der einer medikamentösen Behandlung zugrunde liegt. Der Beipackzettel verbleibt daher oftmals zusammengefaltet im Päckchen. Wenn man sich doch die Zeit nimmt, die Angaben des Beipackzettels zu studieren, vergeht schnell die Lust an der Einnahme, denn […]
So mancher spart sich heutzutage den Arztbesuch, weil er sich vor einer weiteren Antibiotikaverschreibung schützen will. Einige lassen die Erkrankung frei nach dem Motto „Mit Antibiotika sieben Tage bis zur Heilung und ohne eine Woche“ natürlich abklingen. Eine umfassende Auswertung von Patientendaten hat nun ergeben, bei welchem Krankheiten zu häufig verschrieben werden. Weiterhin konnte ermittelt […]
Was sollte ich tun, wenn es für meine Nerven eng wird. Wenn das Nervengewebe im Lendenbereich eingeschnürt ist kann das sehr schmerzhaft sein. Dennoch ist eine OP nicht immer der beste Weg. Dr. Sven Eicker ist Neurochirurg am Hamburger Uniklinikum. Wenn Patienten mit Rückenschmerzen zu ihm kommen und behaupten, dass sie beim Fahrrad fahren gar keine […]
Die Zahl der Übergewichtigen steigt weltweit immer weiter an, weshalb sich stark adipöse Menschen immer häufiger für eine operative Magen-Verkleinerung entscheiden, um ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Die Zahl der Patienten, die zu dieser drastischen Maßnahme greifen, hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dies enthüllt der kürzlich veröffentlichte Report der Barmer GEK, […]
Zwei Jahre ist es nun schon her, dass die „Ice Bucket Challenge“ ins Leben gerufen wurde und letztendlich durchaus mit Erfolg. Für diese Challenge haben unglaublich viele Menschen sich Eiswasser über den Kopf schütten lassen. Bei der Aktion ging es vor allem darum, Geld für die ALS-Forschung zu sammeln. Jetzt berichten Forscher allerdings, dass im […]
Eine Infektion mit dem Darmkeim Clostridium difficile beginnt mit Krämpfen, Blähungen und starkem Durchfall. Die Zahl der mit dem Darmkeim Clostridium difficile Infizierten steigt weltweit an und ist zwischen 2002 und 2006 in Deutschland auf das Doppelte gestiegen. Dabei sind immer mehr Patienten mit einem schweren Verlauf der Erkrankung zu beobachten. Bei der Standardtherapie, der […]
Im deutschen Gesundheitssystem ist eine Kommunikation zwischen Arzt und Patient nicht vorgesehen. Der behandelnde Arzt erhält für einen Patienten eine Pauschale sowie eine Vergütung bestimmter Behandlungsmethoden. Dabei können verschiedene Studien zeigen, dass die Kommunikation zwischen dem Arzt und dem Patienten einen Einfluss auf den Erfolg einer Behandlung hat. Viele Patienten sind mit der Arztkommunikation nicht […]