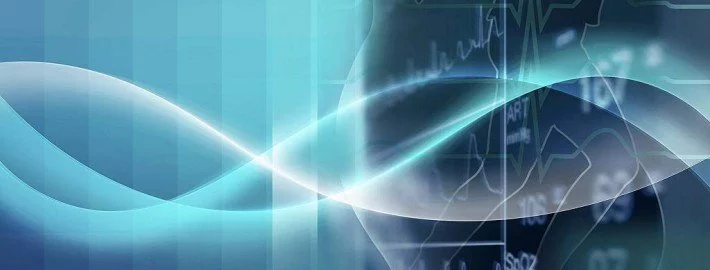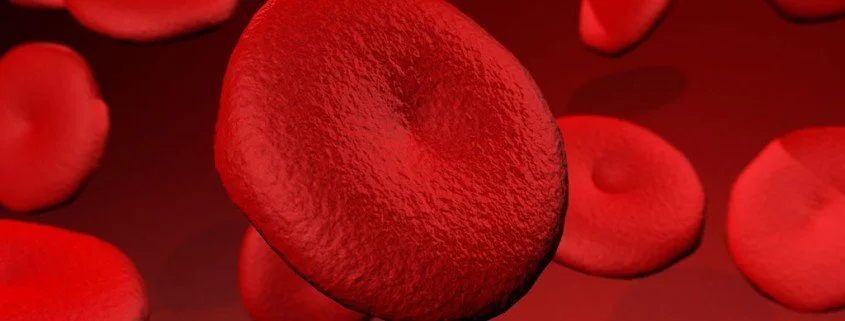Wacht man morgens mit schwerwiegenden Kopfschmerzen auf, kann das mehrere Ursachen haben. Unter anderem kann die Kiefermuskulatur dafür verantwortlich sein. Dies kann mit einer Biss-Fehlstellung, auch Craniomandibulärer Dysfunktion genannt, zusammen hängen. Cranio bedeutet Schädel und Mandibula ist der Unterkiefer. CMD ist zunächst einmal ein Überbegriff für Störungen im Schädel und Unterkiefer. Damit werden Schmerzen im […]
Archiv für die Kategorie: Krankheitsbilder
Du bist hier: Home » Krankheitsbilder » Seite 13
Gesundheit Krankheitsbilder
Eigentlich ist Clostridium difficile in angemessener Menge vorkommend ein relativ harmloses Darmbakterium. Muss man – aus welchem Grund auch immer -, Antibiotika zu sich nehmen, sei es präventiv nach Eingriffen oder Operationen oder kurativ bei Infektionen, werden in der Regel große Teile der Darmflora aus dem Gleichgewicht gebracht oder sogar zerstört. In diesem Fall kann […]
Bei Chorea Huntington handelt es sich um eine Erkrankung des Gehirns, die vererbt wird. Das Gehirn wird über die Jahre hinweg schwer zerstört. Sowohl die Muskelsteuerung als auch psychische Funktionen sind davon betroffen. Das fehlerhafte Gen ist außerdem dafür verantwortlich, dass die Nervenzellen nach und nach absterben. Studien besagen, dass in Deutschland ungefähr 8.000 Menschen unter der […]
Es gibt wohl kaum einen jungen Menschen, der zum Thema Akne nichts zu sagen hätte. Untersuchungen zu Folge sind etwa 85 Prozent der Bevölkerung zeitweise davon betroffen. In der Regel tritt die Akne während der Pubertät zum ersten Mal auf. Aufgrund der hormonellen Veränderungen im Körper entstehen die typischen Mitesser und Pickel. In den meisten Fällen klingt […]
Die Achillessehne (Tendo Calcaneus) ist die stärkste Sehne, die der menschliche Körper aufweist. Sie stellt die Verbindung zwischen dem Fersenknochen – dem sogenannten Fersenbein – und der Wadenmuskulatur dar. Die Sehne ist notwendig um zum Beispiel, auf den Zehenspitzen zu stehen sowie für das Abstoßen beim Laufen und beim Springen. Vom Riss der Achillessehne sind oft sportliche […]
Wer sichergehen möchte, dass er nicht an einem chronischen Eisenmangel leidet, kann dies zwar durch den Gang zum Hausarzt schnell überprüfen lassen, doch um einen dauerhaft gesunden Eisenhaushalt zu gewährleisten, ist ein gewisses Maß an Eigenverantwortung gefragt: Wie wir im Folgenden nämlich noch genauer anschauen werden, ist die Ernährung ein entscheidender Faktor, um die lästigen Symptome eines […]
Vielleicht kennen Sie das ja aus eigener Erfahrung? „Mei, is heit a Föhn“ sagen beispielsweise Münchner an einem klaren Tag, an dem die Alpen, wenn auch Hunderte von Kilometern entfernt, zum Greifen nah scheinen. Der warme Fallwind aus den Alpen ist in „Minga“ Ausrede für schlechte Laune, aggressives Verhalten und eben auch Migräne und Kopfweh. […]
Vielleicht haben Sie das ja auch schon erlebt? Wenn Kinderkrankheiten bei einem Erwachsenen auftauchen, erntet dieser oft allerseits großes Gelächter. Seien es die Windpocken oder Masern. Anders als der Name vermuten lässt, können auch Erwachsene sich mit Keuchhusten, Röteln und Mumps anstecken. In den meisten Fällen treten Kinderkrankheiten in den ersten Lebensjahren auf, weil sie […]
Das Phänomen der Wetterfühligkeit betrifft viele Menschen. Sie klagen über Kopfschmerzen und schlechte Stimmung. Diese Störung tritt immer dann auf, wenn sich Luftdruckschwankungen oder ein bevorstehendes Gewitter ankündigen. Wer unter Wetterfühligkeit leidet, klagt oft auch über mangelnde Leistungsfähigkeit und allgemeines Unwohlsein. Dabei fällt auf, dass sich unter den Betroffenen dreimal so viele Frauen wie Männer befinden. Die […]
Schaufensterkrankheit – dieser Name lässt eher an einen kleptoman veranlagten oder modesüchtigen Menschen denken, jedoch nicht an eine ernstzunehmende Gefäßerkrankung. Diese ist es jedoch, welche sich hinter dem etwas ironisch anmutenden Namen verbirgt. Der Begriff rührt daher, dass Betroffene auf Grund ihrer Symptomatik – hauptsächlich starker Schmerzen in den Beinen – häufig stehen bleiben müssen […]