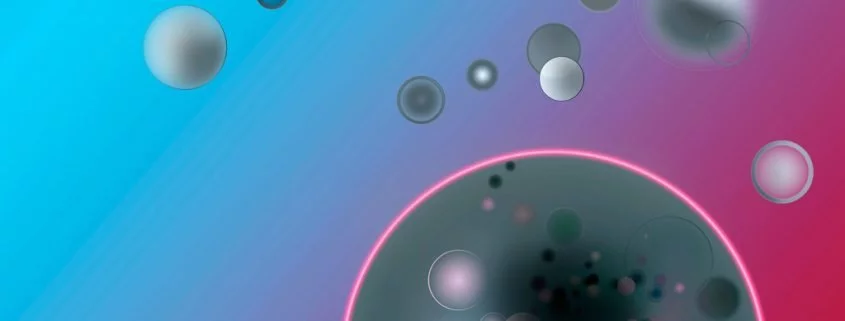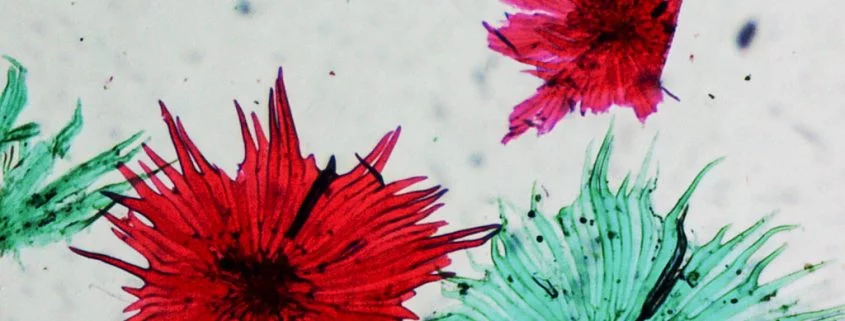Regelmäßiger Kaffeekonsum soll das Risiko von Darmkrebs senken. Doch welche Behandlungsmöglichkeiten daraus entstehen könnten, bleibt noch zu erforschen. Positive Wirkung durch Röstung Ein Team aus Wissenschaftler der University of Southern California unter der Leitung von Stephen Gruber hat herausgefunden, dass Kaffeekonsum in einem direkten Zusammenhang mit dem Risiko von Krebserkrankungen am Enddarm steht. Das koffeinhaltige […]
Archiv für die Kategorie: Forschung & Wissenschaft
Du bist hier: Home » Forschung & Wissenschaft » Seite 5
Gesundheit Forschung & Wissenschaft
Kleinkinder in Afrika können Hoffnung schöpfen: Eventuell besteht bald die Möglichkeit, diese Kinder gegen Malaria zu impfen. So wurde von der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ein Serum positiv gegen die Tropenkrankheit bewertet. Laut der Behörde könne der Impfstoff für den Schutz von Kindern sorgen. Das Mittel trägt den Namen RTS,S und entspringt der jahrzehntelangen Forschung des […]
Wenn Menschen Gewicht verlieren wollen greifen sie häufig auch zu Tabletten. Doch die in Diätpillen enthaltenen Chemikalien bergen große Gefahren und können auch tödlich wirken. Immer mehr Menschen möchten gerne abnehmen Oftmals ist der Schlüssel zum Gewichtsverlust eine gesündere Ernährung, regelmäßiger Sport oder eine Diät. Doch werden in der Öffentlichkeit auch viele Wundermittel angepriesen, die die […]
Zum Glück ist es ein Irrtum! Die Vermutung, die 2007 geäußert wurde und nach der wir ein höheres Risiko hätten an Blutkrebs zu erkranken, wenn wir regelmäßige Nachtschichten einlegen, stimmt nicht. Studie belegt das nächtliche Aktivität das Brustkrebsrisiko erhöht Das kann man nach einer Studie für die 1,4 Millionen Frauen befragt wurden sagen. Für die […]
Die menschliche Darmflora bietet genügend Stoff für Wissenschaftler und Forscher um herauszufinden, ob sie für bestimmte Krankheiten oder Heilungen verantwortlich sein kann oder inwiefern sie durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wird. Einer veränderten Darmflora werden mittlerweile sämtliche Zivilisationskrankheiten, wie Diabetes, Darmkrebs oder Übergewicht zugeschrieben. In Ratgebern werden Probiotika und Nahrungsergänzungsmittel für den Darm empfohlen und vor […]
Impfungen sind wichtig, denn zahlreiche Menschen wurden durch sie bereits vor vielen Krankheiten geschützt. Dabei sorgt der Erreger selbst dafür, dass die schützende Wirkung entsteht. Bei den Krankheiten Pocken, Polio und Gelbfieber werden Lebendimpfstoffe mit abgeschwächten Viren genutzt. Neue Methode zur Herstellung von Impfstoffen Die Impfung mit Lebendimpfstoffen ist zwar sehr effektiv, kann aber auch […]
Kalte Frauenfüße, die sich unschuldig zwischen die warmen Oberschenkel des Mannes schmuggeln. Die meisten deutschen Schlafzimmer haben mit dieser Situation regelmäßig zu kämpfen. Zum Leidwesen der Frau mit ihren eisigen Füßen und zum Leidwesen des Mannes, welcher als lebende Wärmflasche missbraucht wird. Für kalte Füße gibt es mehrere gute Gründe. Warum ausgerechnet Frauen mehr unter […]
Oft heißt es fettreduzierte Milchprodukte seien gesünder und Milchfette solle man meiden. Forscher schreiben jedoch nun überraschend den Milchfetten eine sehr positive Wirkung zu. Der Ratschlag, besser fettreduzierte Milchprodukte zu verzehren, wird vielfältig begründet. Man könne so an Gewicht verlieren und Übergewicht vorbeugen und außerdem senke diese Strategie den Cholesterin-Spiegel und mindere das Diabetes-Risiko. Wissenschaftler […]
Nach so vielen Jahren der Forschung und Medizin hatten wohl die wenigsten damit gerechnet, doch jetzt kam die Sensation. Der Mensch hat ein weiteres Organ. Obwohl der menschliche Körper seit Jahrhunderten im Mittelpunkt zahlreicher Forschungen stand und auch immer noch steht, haben Forscher erst jetzt ein weiteres Geheimnis lüften können. Was ist das Mesenterium? Es […]
Forschern aus St. Gallen ist kürzlich ein wahrhaftiger Durchbruch gelungen: Sie konnten erfolgreich Superkeime mit Peptiden bekämpfen. Normalerweise werden diese Peptide von unserem Körper zu schnell abgebaut, die Wissenschaftler scheinen jedoch eine Lösung gefunden zu haben. Peptide im Shuttletransport Die Forscher der Empa in St. Gallen haben sich nun dieses Problems angenommen. Peptide können selbst […]