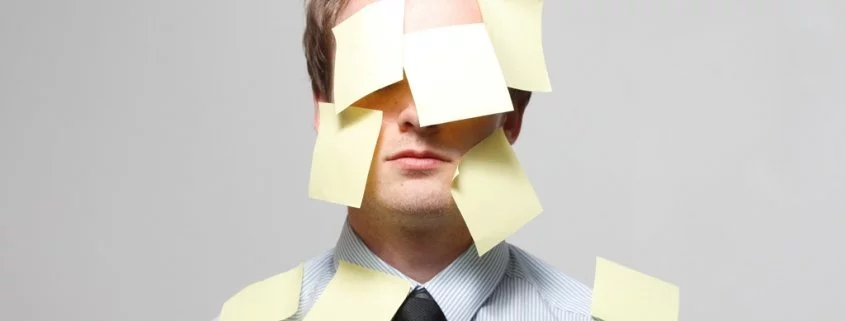Die Wechseljahre sind vorbei und die Postmenopause tritt ein. Nach der Hormonumstellung hat das Chaos, welches durch einen erst steigenden, dann wieder sinkenden Östrogenspiegel entstanden ist, endlich ein Ende. Doch nun entstehen neue Probleme, da der Körper die Produktion von Östrogen vollständig eingestellt hat. Was Frau dagegen unternehmen kann, haben wir nachfolgend zusammengefasst. Bewegung stärkt […]
Archiv für die Kategorie: Gesundheit im Alltag
Du bist hier: Home » Gesundheit im Alltag » Seite 4
Gesundheit im Alltag
Während der Menopause spielen die Hormone regelrecht verrückt. Da nicht jede Frau sofort damit umzugehen weiß, haben wir die häufigsten Beschwerden und was dagegen hilft nachfolgend zusammengefasst. Welche Folgen ein zu hoher Östrogenspiegel in der Menopause hat Ein erhöhter Östrogenspiegel zieht berührungsempfindliche Brüste und geschwollene Gelenke nach sich. Dies wird von einem Großteil der Frauen […]
Ein BEM (Eingliederungsmanagemant) muss seit 2004 jeder Arbeitgeber einem länger erkrankten Beschäftigten anbieten. Damit wird die Beschäftigungsfähigkeit abgesichert und man geht gegen den demographischen Wandel vor. Desweiteren kann ein BEM auch zur frühzeitigen Sicherung des Arbeitsplatzes führen. Im Gesetzbuch ist das BEM verankert und dort steht, dass Arbeitnehmer die innerhalb von einem Jahr sechs Wochen […]
Viele haben Probleme, die das Aussehen der Haare dauerhaft beeinflusst. Diese dauerhaften Probleme können beispielsweise juckende Kopfhaut, Schuppen oder Haarausfall sein. Gegen diese Haarprobleme gibt es viele Pflegeprodukte im Supermarkt. Jedoch helfen diese nicht immer. Was Du gegen Schuppen tun kannst Generell ist ein Anti-Schuppen-Shampoo empfehlenswert. Dieses sollte jedoch nicht zu lange angewendet werden, da die […]
Die Sonne ist eigentlich ein guter und lebenswichtiger Freund von uns und ohne sie können wir nicht leben. Aber es gibt auch hier, wie bei allem, ein zuviel des Guten. Wie Du Dich besser schützen kannst, erfährst Du un unseren Tipps gegen Sonnenbrand: 1. Sonnencreme Trage genügend Sonnenmilch auf: 25 ml pro Körper dürfen es […]
Ein Uhr, drei Uhr, fünf Uhr – und immer noch kein Auge zu oder schon wieder wach? So ergeht es vielen Menschen mitten in der Nacht. Tiefer Schlaf ist für sie Mangelware, also wird sich weiterhin im Bett hin und her gewälzt. Welche Mittel helfen dagegen und wo liegen die Risiken? Die Ursachen für Schlaflosigkeit […]
Für die meisten sind Quallen einfach nur lästig, doch für wenige können Sie auch tödlich enden. Wir zeigen, welche Mittel nach einem Stich von einer Qualle wirklich helfen. Etwa mehrere Dutzend Menschen sterben pro Jahr durch Quallenstiche. Entstellenden Narben und sehr starke Schmerzen erleiden sogar Tausende jedes Jahr. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen, wenn es […]
Wie entsteht er eigentlich der Kater in den Muskeln? Genau beantworten kann man diese Frage bisher leider nicht. Es gibt jedoch verschiedene Theorien darüber, wie er entsteht. Zum einen wird davon ausgegangen, dass Muskelkater mit einer vermehrten Milchsäurebildung zusammenhängt. Zum anderen gehen manche Wissenschaftler davon aus, dass Muskelkater auf Blutergüsse zurückzuführen ist. Mittlerweile geht man aber […]
Woher kommen Nackenschmerzen eigentlich genau? Dieser Frage wollen wir im folgenden Artikel nachgehen und dabei praktische Übungen zur Lösung des Problems vorstellen. Im Bereich unseres Nackens gibt es zwei verschiedene Arten von Muskeln, die oberflächlichen und die tiefliegenden Muskelgruppen. Die oberflächlichen Muskeln tragen zur Bewegung unseres Kopfes bei, hingegen sind die tiefliegenden Muskeln für die Bewegung […]
Auf vielen Pflegeprodukten steht aufgedruckt der Begriff „rückfettend“. Wir beschreiben Dir, was es damit auf sich hat. Eigentlich hört sich rückfettend an, als sei es irgendeiner Marketingabteilung entsprungen. Doch in der Tat wird mit rückfettend eine Wirkung in der Dermatologie bezeichnet. Die rückfettenden Produkte helfen der Haut, den natürlichen Schutzfilm nicht nur zu erhalten, sondern […]