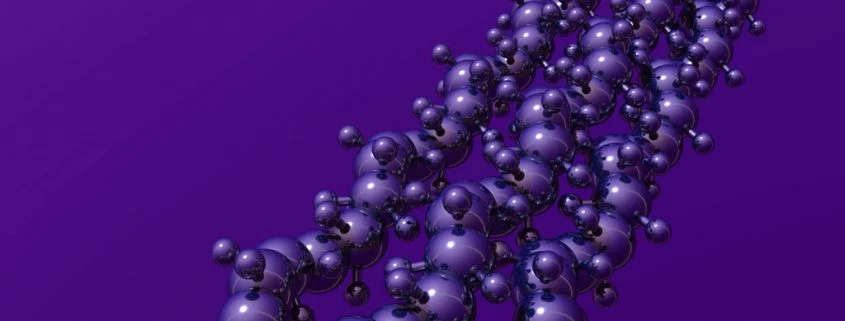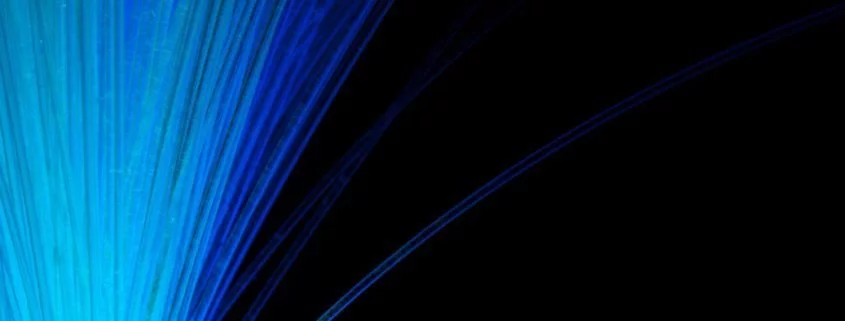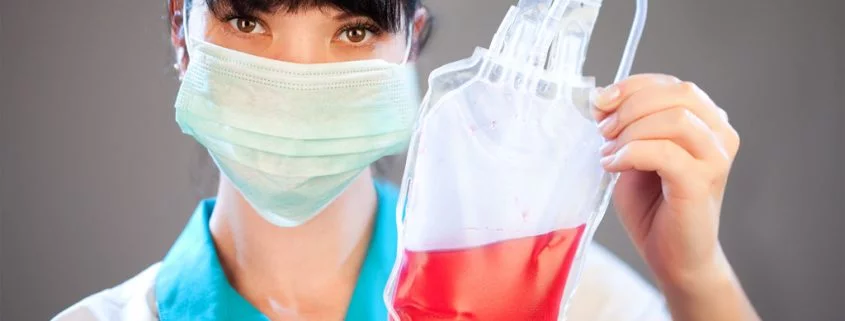Normalerweise verbinden wir Botox lediglich mit Schönheitswahn und aufgespritzten Lippen. Doch Forscher fanden nun anhand einer Studie heraus, dass Botulinumtoxin möglicherweise an der Borderline-Störung erkrankten Menschen helfen kann. Soziale Instabilität Prof. Tillman Krüger arbeitet an der MH Hannover im Bereich Psychiatrie. Er erklärt, Botox könne womöglich als erstes Medikament zugelassen werden, welches gegen Persönlichkeitsstörungen helfen […]
Archiv für die Kategorie: Forschung & Wissenschaft
Du bist hier: Home » Forschung & Wissenschaft » Seite 7
Gesundheit Forschung & Wissenschaft
Das Risiko für geistige und körperliche Schäden ist bei Kindern, die vor der 32. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen erhöht. Dagegen kann allerdings Muttermilch helfen. Eine Frühgeburt kann für das Kind sehr gefährlich sein. Nicht selten kommt es vor, dass das Kind neurologische Spät- und Folgeschäden im Gehirn hat. In der Regel passiert das bei […]
Um dauerhaft gesunde und schöne Zähne zu haben, ist eine regelmäßige Mund- und Zahnpflege zwingend nötig, denn nur so lassen sich Folgeerkrankungen wie etwa Karies vermeiden. Doch stimmt auch alles, was man so über Zahnpflege hört? Vistano räumt mit den Gerüchten auf und erklärt Dir, welche Tipps für Dich wichtig sind. Schlechte Zähne und Karies […]
Schmerzmittel wie beispielsweise Morphium sind heutzutage aus der Medizin gar nicht mehr wegzudenken. Doch meist verursachen solche Opioidschmerzmittel verheerende Nebenwirkungen und können sogar zur Abhängigkeit führen. Daher bemühen sich Wissenschaftler seit geraumer Zeit, Opioidvarianten chemisch derart abzuwandeln, dass sie verträglich und ungefährlich werden. Starke Nebenwirkungen und Abhängigkeit durch Schmerzmittel Forscher der Universität Erlangen-Nürnberg haben nun […]
Eine Infektion mit dem Darmkeim Clostridium difficile beginnt mit Krämpfen, Blähungen und starkem Durchfall. Die Zahl der mit dem Darmkeim Clostridium difficile Infizierten steigt weltweit an und ist zwischen 2002 und 2006 in Deutschland auf das Doppelte gestiegen. Dabei sind immer mehr Patienten mit einem schweren Verlauf der Erkrankung zu beobachten. Bei der Standardtherapie, der […]
Im menschlichen Darm tummeln sich, wie bereits allseits bekannt, unzählige Bakterien. Doch auch Viren finden sich zu Hauf dort wieder. Forscher haben nun intensiv ergründet, welche Folgen dies für uns haben kann. Zehnmal mehr Viren Wissenschaftler fanden heraus, dass eine Vielzahl von Viren, die in unserem Verdauungstrakt zu finden sind, harmlos zu sein scheinen. Dazu […]
Jeder von uns hat bestimmt noch die Warnung des Chemielehrers im Ohr: „Auf keinen Fall destilliertes Wasser trinken!“ Doch was ist dran an dieser Theorie und warum schwören manche Menschen gerade auf dieses Wasser und seine angeblich säubernde Wirkung? Können unsere Zellen platzen? Nur allzu oft liest und hört man davon, dass destilliertes Wasser unsere […]
Google ist eine amerikanische Suchmaschine des Google Inc. Unternehmens. Google ist der weltweite Marktführer, wenn es um Suchanfragen im Internet geht. Jeder kennt Google heutzutage. Vielleicht ist Google aber auch in der Lage, noch viel mehr zu vollbringen. Wird es in Zukunft möglich sein, mit der Technik von Google Asthma und Diabetes zu heilen? Das […]
Eine Lebendspende ist für eine Transplantation, auf die in Deutschland mehrere Tausend Menschen warten, zwar eine Möglichkeit, die die Wartezeit verkürzen kann, birgt aber auch Risiken. Amerikanische Forscher testeten nun, wie eine Blutwäsche vor dem Transplantieren einer Lebendspende das Abstoßungsrisiko beeinflusst. Immerhin kommt es bei diesen Spenden nicht selten vor, dass das Organ nicht optimal […]
Gemeinsam mit dem Smartphone soll jetzt ein Sensor auf der Haut vor Sonnenbrand schützen! Das Angebot an Sonnenschutzmitteln ist enorm, es gibt Cremen, Lotionen, Öle, Sprays und sogar Sonnenschutz, den man trinken kann. Der übersättigte Markt braucht Neuheiten und da kommt La Roche-Posay gerade richtig. Sie haben den „My UV Patch“ erfunden. Anhand einer Verbindung von […]