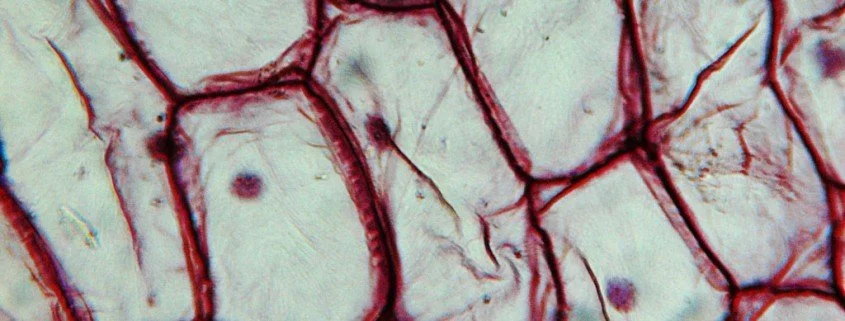Unsere technologische Entwicklung gleicht sich immer mehr der Science Fiction Geschichten von vor nur ein paar Jahrzehnten an. Wissenschafter arbeiten an Geräten, um Querschnittsgelähmte wieder einige Möglichkeiten zurückzugeben, die sie vor ihrer Verletzung mit eine normal funktionsfähigen Körper hatten. Vielleicht können sie aber auch bald mehr als vorher – denn bereits jetzt lassen sich von […]
Archiv für die Kategorie: Forschung & Wissenschaft
Du bist hier: Home » Forschung & Wissenschaft » Seite 10
Gesundheit Forschung & Wissenschaft
Nicht nur die dunklen Amalgam-Füllungen können wegen des darin enthaltenen Quecksilbers zu gesundheitlichen Problemen führen – auch moderne Kunststofffüllungen aus Acrylat (Plexiglas) und weiteren Bestandteilen wie beispielsweise Silizium sind nicht ganz risikofrei. Im Gegensatz zu Arzneimitteln müssen Zahnkunststoffe nicht durch eine Zulassungsprüfung. In ihnen ist oft noch der Weichmacher Bisphenol A enthalten, der in Babyschnullern […]
Menschliche Spermien aus dem Reagenzglas – französische Forscher wollen das nun geschafft haben. Handelt es sich hierbei um einen sensationellen Durchbruch der medizinischen Forschung? Forscher bleiben skeptisch und wollen Ergebnisse sehen. Das Team des Forschers Philippe Durand vom Unternehmen Kallistem gab bekannt, erstmals ein menschliches Spermium in vitro hergestellt zu haben. Dazu sollen sie Vorläuferzellen […]
In Rennes spielten sich die letzten Tage furchtbare Szenen ab. Nach einem Zwischenfall bei einem Medikamententest in Rennes gab es einen Todesfall und mehrere Schwerverletzte. Dieses Ereignis stellt Medikamententests generell in Frage und ruft nach neuen Richtlinien für den Umgang mit dieser Art von medizinischen Tests auf. Von öffentlicher Seite war zu erfahren, dass das […]
War es früher nicht möglich, eine Erblindung zu heilen, so wurden im Laufe der Zeit Verfahren entwickelt, die eine Erblindung zu heilen versprechen. Nun hoffen Forscher, mit der Möglichkeit der Lagerung und des Transports von Stammzellen einen großen Schritt bei der Behandlung der Limbus-Stammzelleninsuffizienz erzielt zu haben. Ursachen einer Limbus-Stammzelleninsuffizienz Als Risikofaktor für die Limbus-Stammzelleninsuffizienz gilt eine übermäßige UV-Strahlung. […]
Um es gleich vorweg zu nehmen: Natürlich ist eine akute Migräne-Attacke nicht hilfreich, um irgendwelche Probleme zu lösen. Wer unter der Krankheit leidet, weiß gut genug um die Einschränkungen während einer Anfalls. Allerdings ging die Medizin bisher davon aus, dass Migräne-Patienten bei der Lösung von Problemen eher langsamer sind als andere. Neue Forschungsergebnisse jedoch belegen das […]
Bei vielen Menschen sind die schwarz-gelb-gestreiften Insekten eher unbeliebt. Doch fanden Wissenschaftler der Universität von Sao Paolo und der Universität von Leeds nun heraus, dass das Gift der Wespen für die Krebsforschung wichtig sein könnte. Genauer gesagt, das Gift einer brasilianische Wespenart mit dem Namen „Polybia paulista“. Anscheinend wirkt das Gift dieser Wespe gegen Tumorzellen, jedoch ohne dabei gesunde […]
Ein 1984 in Zürich durchgeführtes Experiment, an dem 10 Männer teilnahmen, führte zur Unabhängigkeit für den Mann in Verhütungsfragen. Durch Gewichte nach unten gezogen, baumelten die Hoden der Männer vier Wochen lang täglich eine Dreiviertelstunde in 45 Grad warmen Wasser. Das führte zur Unfruchtbarkeit. Wippschalter am Hoden stoppt Spermien Das Experiment war dennoch nicht von […]
Das Medikament Paracetamol wird von Schmerzpatienten und auch von Ärzten häufig verwendet, wenn es um die Behandlung von akuten Rückenschmerzen geht. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass dessen Wirkkraft dem eines Placebos gleicht. Die im Medizinjournal „The Lancet“ veröffentlichte australische Studie zum Medikament Paracetamol umfasst 1650 Probanden, die an akuten Rückenschmerzen leiden. Männer und Frauen […]
Die fortschrittliche Technik jagt so Manchem Angst ein. Immer mehr Möglichkeiten kommen auf, die unser Leben mit Hilfe von Technik und Medizin verändern. Nie zuvor haben Menschen, die an lebensgefährlichen Krankheiten leiden, so lange gelebt wie heute. Nun setzen chinesische Forscher noch einen drauf: ihnen ist es gelungen Embryos im Labor genetisch zu verändern. Damit […]